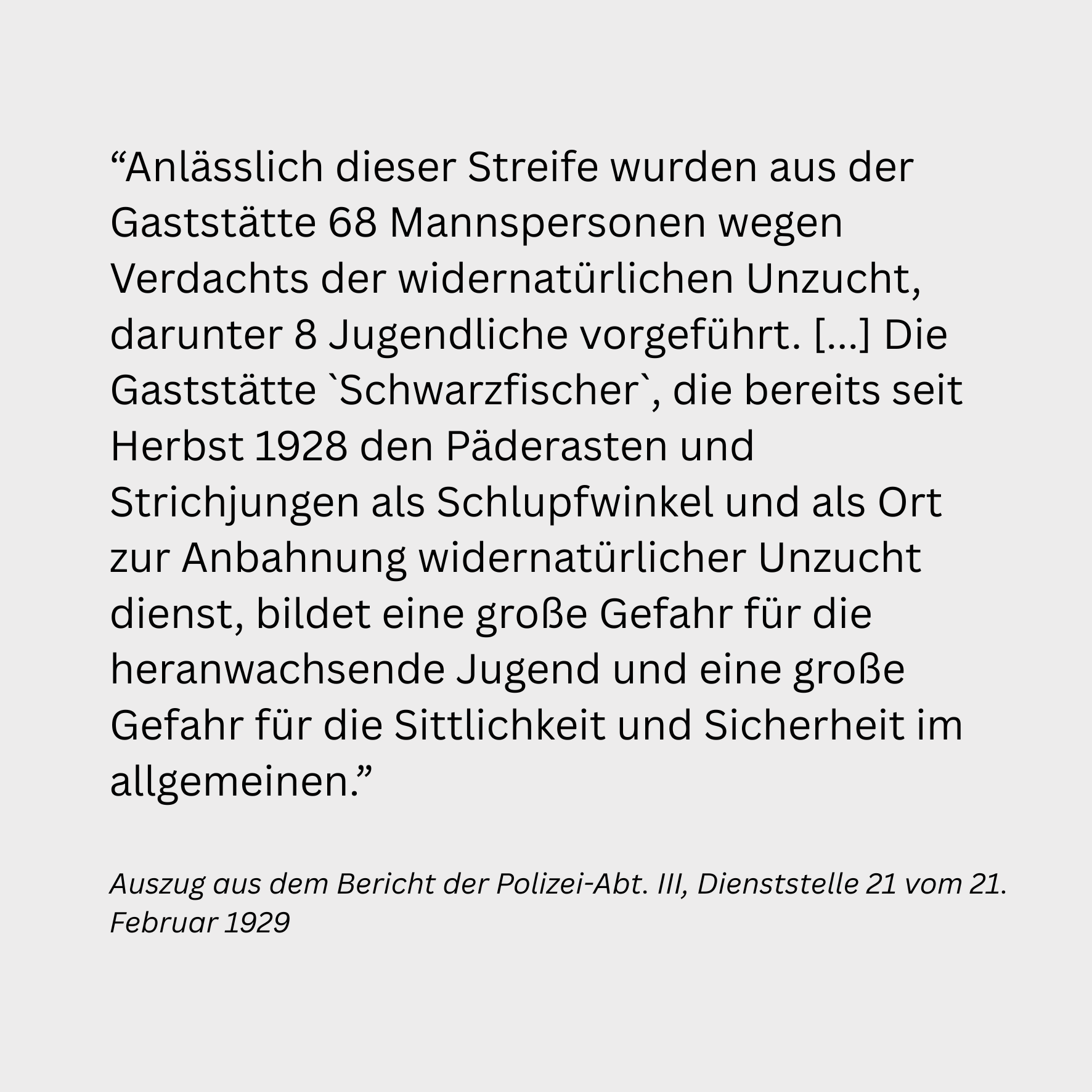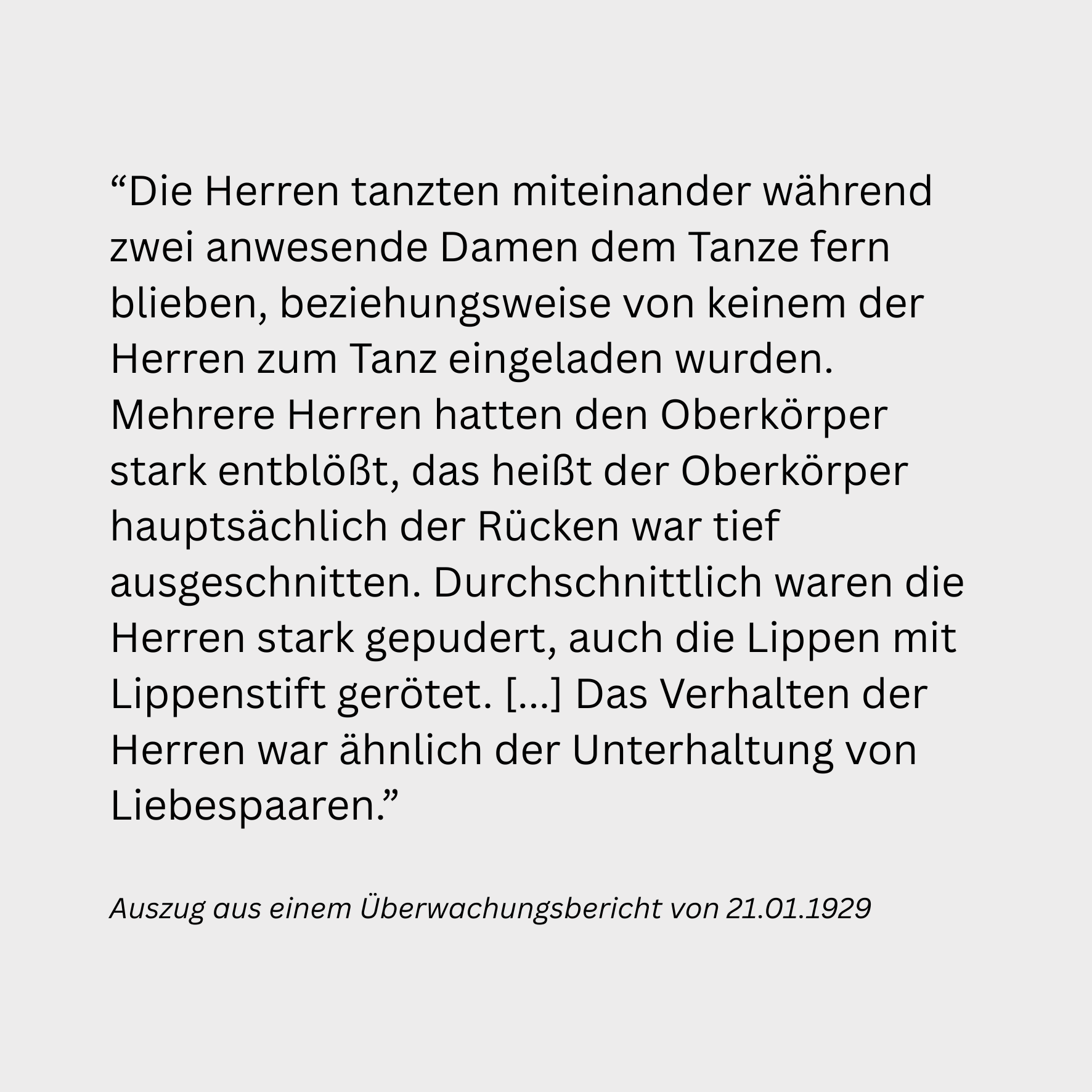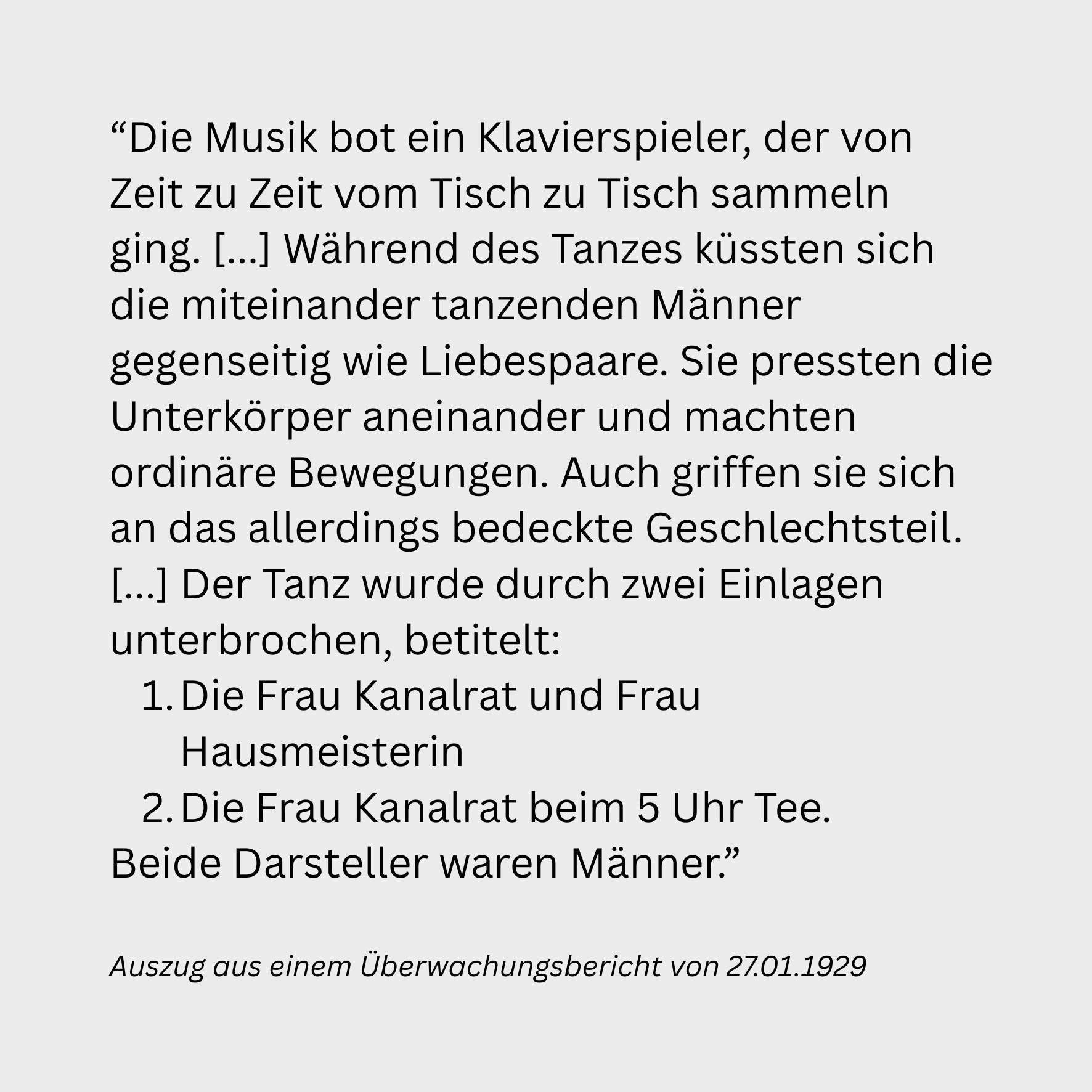Homosexuellenverfolgung im nationalsozialistischen München
Razzien, Durchsuchungsaktionen und Kontrollen
Die größte bekannte Razzia gegen Homosexuelle fand am 23. Oktober 1934 statt. Am Abend wurden alle größeren Parkanlagen durch Sonderstreifen abgesucht, der Englische Garten, die Gasteig- und Maximiliananlagen, der Ausstellungspark mit den Anlagen um die Bavaria sowie zahlreiche Bedürfnisanstalten.
Betroffen waren ferner mehrere Lokale in der Innenstadt, die als beliebte Treffpunkte von Homosexuellen galten, wie das »Bratwurstglöckl« (Frauenplatz 9), der »Schwarzfischer« (Dultstraße 2) oder der »Arndthof« (Glockenbach 12).
52 Männer wurden in ihren Wohnungen festgenommen – bei der Auswahl der betreffenden Personen hatte man sich auf eine bereits existierende Kartei von über 5.800 einschlägig erfassten Personen gestützt. Insgesamt wurden 145 Männer vorläufig inhaftiert. Auch in der Folgezeit fanden immer wieder Durchsuchungsaktionen und Kontrollen statt. In den Jahren 1937 und 1938, dem Höhepunkt der nationalsozialistischen Homosexuellenverfolgung, wurden im Bereich der Münchner Kriminalpolizeileitstelle 3.158 Männer wegen Vergehens (bzw. Verdachts) gegen den §175 festgenommen – mehr als in jedem anderen Leitstellenbezirk des Deutschen Reichs.
Das Schicksal des Schneiders Franz K.
Wenige Tage nach der »Rohm-Affäre«, am 3. Juli 1934, wies Innenminister und Gauleiter Adolf Wagner die Polizeibehörden an, in allernächster Zeit »schlagartig« gegen Homosexuelle vorzugehen. (StAM, LRA151016)
Der österreichische Schneider Franz K. wurde während der Razzia am 23. Oktober 1934 festgenommen und in das KZ Dachau eingeliefert. Im November 1935 wurde er zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, nach Verbüßung der Strafe ausgewiesen.
(StAM, Pol. Dir. 14749)
Weitere Quelle: Die Münchner Polizei und der Nationalsozialismus


Vorbeugehaft, Kastrationen, Hinrichtungen
Der »Grundlegende Erlaß über die vor-
beugende Verbrechensbekämpfung« (1937) bot eine Möglichkeit, auch gegen Homosexuelle ohne richterliches Urteil vorzugehen. Eines seiner Opfer war der Münchner Lagerarbeiter Wilhelm Kaiser der am 27. September 1940 von der Kriminalpolizei München in Vorbeugehaft genommen und einen Monat später, am 23. Oktober, in das KZ Dachau eingeliefert wurde. Von dort wurde Kaiser
in das Konzentrationslager Neuengamme verbracht, wo er am 6. Januar 1943 verstarb. Mit dem »Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken NachwucHase« (1933) wurde die Möglichkeit einer »freiwilligen« Kastration geschaffen - später in der Praxis als Bedingung dafür, nicht in ein KZ eingewiesen zu werden. In der JVA Stadelheim ist die Krankenakte des Schlossers Michael W. erhalten geblieben,
der wegen Verstoßes gegen § 175 RStGB und nach einer Vorstrafe zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und am 22. Juli 1943 in Stadelheim eingeliefert worden war. In einem Eintrag in seiner Akte heißt es: »Der Beschuldigte hat sich bereit erklärt, sich freiwillig entmannen zu lassen«. Die Operation wurde im Krankenhaus rechts der Isar durchgeführt.
In Fällen, die als besonders »schwerwiegend« galten, fällten Gerichte auch Todesurteile. So wurde etwa der ehemalige Schneider und Oberscharführer Georg L. im Dezember 1941 wegen Diebstahls, missbräuchlicher Verwendung von Bezugsscheinen sowie Verstoßes gegen §§ 175a, 174 RStGB (Unzucht mit minderjährigen Schutzbefohlenen) festgenommen, verurteilt und am 26. Juni 1943 in Stadelheim hingerichtet.
Quelle: Die Münchner Polizei und der Nationalsozialismus

Und wie sah es im restlichen Bayern aus?
Hier ein Beispiel aus Oberbayern
Die neugeschaffene ”Reichszentrale zur Bekämpfung von Abtreibung und Homosexualität” war seit 1936 unter der Leitung Josef Meisingers damit beschäftigt, den inkriminierten Personenkreis möglichst lückenlos zu erfassen.
Nach vier Jahren Arbeit hatte die als oberste Polizeibehörde tätige Reichszentrale 41.000 Daten von Männern gespeichert, die als homosexuell bestraft worden waren oder als solche verdächtigt wurden.
Ein Beispiel, das für viele individuelle Schicksale steht, soll den reibungslosen Informationsfluss zwischen den Verfolgungsbehörden des nationalsozialistischen Staates verdeutlichen.
Der 32jährige Heinz F., Jurist, brach am Morgen des 18. September 1937 mit dem Auto zu einem Ausflug ins Gebirge auf. Mit einem Freund, dem zehn Jahre jüngeren Ernst Sch., fuhr er von München nach Berchtesgaden. Sie übernachteten gemeinsam in einem Gasthaus.
In der Nähe von Rottach-Egern wurden sie in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein Mensch zu Tode kam. Die Schuld wurde ihnen zur Last gelegt. Beide kamen in das Amtsgerichtsgefängnis von Miesbach. Nach genauer Durchsicht des Vorstrafenregisters wurde festgestellt, es handle sich bei F. "um einen aktenbekannten Homosexuellen, der bereits ... wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit im K.L. Dachau untergebracht war."
Sch. wurde als angeblicher "Strichjunge" identifiziert, der ebenfalls für fast zwei Jahre in Dachau inhaftiert war. Beide waren erst seit vier bzw. drei Monaten in Freiheit, sie hatten sich wahrscheinlich in Dachau kennengelernt und wollten jetzt ihre Freiheit genießen.
Für den Beamten der Gestapo-Leitstelle München im Wittelsbacher Palais, Josef Gerum, war damit der Fall klar: "Es besteht der dringende Verdacht, nachdem Beide in einem Gasthaus in Bergen und zwar in der Nacht vom 19.9.37 übernachteten, miteinander die Unzucht ausgeübt haben."
Gerum drängte darauf, daß F. sofort im Anschluss an das Strafverfahren wegen des Verkehrsdelikts in Schutzhaft ”verschubt” wird.
Homosexuelle sollten möglichst rasch dem Polizeigewahrsam und damit den Möglichkeiten eines juristischen Verfahrens entzogen und in das Konzentrationslager überstellt werden. Der "dringende Verdacht" eines Beamten reichte aus, um ein neues Verfahren wegen Verstoßes gegen § 175 in die Wege zu leiten.
Die Hauptverhandlung gegen F. wurde auf den 3. Februar 1938 anberaumt, dann verlor sich seine Spur, er hat wohl eine Gefängnisstrafe abgesessen, bis er im Herbst 1939 als KZ-Häftling auftauchte. Erneut begann eine Odyssee durch verschiedene Konzentrationslager: Buchenwald, Natzweiler, Sachsenhausen, wo er Anfang 1945 für den Einsatz in der Wehrmacht entlassen wurde.
F. überstand das Ende des Krieges und lebt heute in hohem Alter in der Nähe von Hannover. Seine Erlebnisse wurden in Tonbandinterviews unter dem Pseudonym Rolf Tischler festgehalten, eine Zusammenfassung dieser Interviews wurden publiziert.
NS-Politiker, wie der Münchner Gauleiter Adolf Wagner oder sein Handlanger in der Gestapo-Leitstelle, Josef Gerum, benutzten nicht nur die politischen Gegner sondern auch die Gruppe der Homosexuellen, um sich innerhalb der Parteihierarchie zu profilieren.
In einem Brief an die Polizeipräsidenten und Stapoämter vom Juni 1937 stellt Wagner fest: "In letzter Zeit mehren sich die Fälle der widernatürlichen Unzucht nach § 175 RStGB. Es muss alles versucht werden, um dieses widernatürliche Laster mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln auszurotten. ... Ich weise deshalb alle Polizeibehörden auf das bestimmteste an, jeden Einzelfall mit unnachsichtlicher Strenge zu verfolgen.
Insbesondere genügt es nicht, nach der polizeilichen Vorbehandlung die Verbrecher den Gerichten zu übergeben. Soferne die Gerichte nicht von sich aus richterliche Haft verhängen, sind die Verbrecher regelmäßig bis zur gerichtlichen Aburteilung in Schutzhaft zu nehmen."
Quelle: Dachauer-Heft 14

Frauen, die von den Weiblichkeitsvorstellungen des Nationalsozialismus abwichen und sich nicht in die Rolle der gebärfreudigen Mutter und dem Manne dienenden Haus- und Ehefrau fügten, waren bereits vor 1933 Zielscheibe rechtsradikaler Propaganda.
Zwar wurde weibliche Homosexualität auch während des „Dritten Reichs“ nicht strafrechtlich verfolgt, aber die lesbische Infrastruktur wurde ebenso wie die der Schwulen zerstört.
Lokale, Zusammenschlüsse oder Zeitschriften, mittels derer lesbisches Sozialleben stattfinden konnte, gab es nach 1933 nicht mehr. Lesbische Sexualität wurde als „asozial“ gebrandmarkt und vereinzelt auch durch KZ-Einweisung geahndet.
Die Konsequenz für frauenliebende Frauen war, ihre sexuelle Identität zu verleugnen. Die Alternative der Emigration stand den Wenigsten offen.
Quelle: Geschichte der Lesben und Schwulen in München
Nachstehende Anzeige aus Berlin (Auszug) Die Freundin Nr. 11/1933

Weibliche Homosexualität
Weibliche Homosexualität war seit 1752 und deshalb auch im NS-Staat nicht strafrechtlich erfasst, da §175 RStG nur Männer betraf.
Dennoch entsprach lesbische Liebe nicht dem Ideal der „Volksgemeinschaft“ und wurde als ideologische Abweichung betrachtet. Obwohl anfangs kein akuter Handlungsbedarf gesehen wurde, gibt es Hinweise auf Verfolgung und Inhaftierung lesbischer Frauen – oft unter dem Vorwand politischer, rassischer oder sozialhygienischer Gründe. Geplante NS-strafrechtsreformen hätten auch weibliche Homosexualität unter Strafe gestellt. Konkrete Lebensgeschichten lesbischer Frauen aus München in dieser Zeit sind bisher nicht oder nur unzureichend dokumentiert.
Die Freundin
Die erste lesbische Zeitschrift „Die Freundin“ erscheint erstmals am 24. August 1924. Herausgeber ist Friedrich Radzuweit, Vorsitzender des Bundes für Menschenrecht. Inhaltliche Schwerpunkte sind Informationen zum lesbischen Leben, Kurzgeschichten und Fortsetzungsromane und Kleinanzeigen. In der Weimarer Republik zirkulieren verschiedene Berliner Zeitschriften für Frauen/Lesben, z.B. „Frauenliebe“, „Ledige Frauen“, „Garçonne“. Bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 müssen sie ihr Erscheinen einstellen.